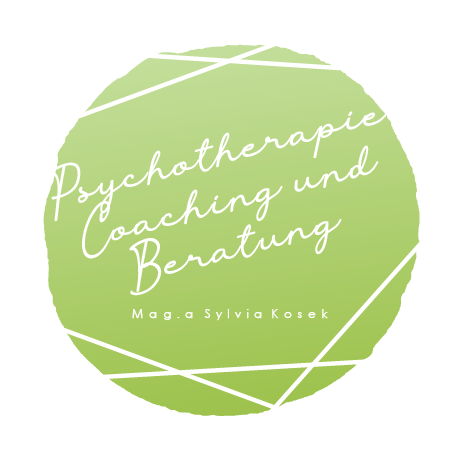16 Tage gegen Gewalt
Sylvia Kosek • 26. November 2025
16 Tage gegen Gewalt: Warum Psychotherapie bei der Bewältigung von Gewalt eine zentrale Rolle spielt
Jedes Jahr zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember finden die „16 Tage gegen Gewalt“
statt – eine internationale Kampagne, die auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen soll. Doch die Aktionstage erinnern uns auch daran, dass Gewalt in all ihren Formen viele Menschen betrifft: körperlich, psychisch, sexualisiert, digital oder strukturell.
Gewalt hinterlässt Spuren – oft tief im Inneren. Psychotherapie kann Betroffenen helfen, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Doch auch für Angehörige und alle, die sich informieren möchten, lohnt ein Blick auf das, was Gewalt mit Menschen macht und wie Heilung aussehen kann.
Was bedeutet Gewalt eigentlich?
Viele denken bei Gewalt zuerst an körperliche Übergriffe. Doch Gewalt hat viele Facetten. Dazu gehören:
• Psychische Gewalt: Beschämung, Abwertung, Drohungen, Isolation
• Sexualisierte Gewalt: Übergriffe, Nötigung, Grenzverletzungen
• Ökonomische oder digitale Gewalt: Kontrolle von Geld, Handy, Kommunikation
• Strukturelle Gewalt: Ungleiche Chancen, Abhängigkeiten, systematische Benachteiligung
Oft kommen mehrere Formen gleichzeitig vor – und oft sind sie unsichtbar.
Viele Betroffene fragen sich: „War das schon Gewalt?“ Oder: „Vielleicht war es gar nicht so schlimm.“
Doch Gewalt beginnt immer dort, wo Grenzen verletzt werden.
Wie wirkt Gewalt auf die Psyche?
Gewalt erschüttert das Vertrauen in andere – und oft auch in sich selbst. Zu den Folgen können gehören:
• Angst und Unsicherheit
• Schlafstörungen oder Albträume
• Übererregung oder Schreckhaftigkeit
• Scham- und Schuldgefühle
• Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen
• Selbstwertprobleme
• Depressionen
• Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Viele Betroffene erleben zudem ein Gefühl von „Gefangensein“ – manchmal sogar noch lange nach dem Ende der gewaltvollen Beziehung.
Wie kann Psychotherapie helfen?
Psychotherapie setzt dort an, wo Gewalt Menschen verletzt hat – seelisch, emotional und im Selbstbild. Je nach Bedarf kann sie:
1. Sicherheit wiederherstellen
Ein erster Schritt besteht darin, Stabilität aufzubauen. Betroffene lernen, innere und äußere Ressourcen zu nutzen und wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.
2. Erlebtes verstehen und verarbeiten
In einem geschützten Rahmen können traumatische Erfahrungen sortiert, benannt und in das eigene Leben eingeordnet werden.
3. Selbstwert stärken
Gewalt vermittelt oft das Gefühl, „nicht gut genug“ oder „schuld“ zu sein. Therapie hilft, ein realistisches, stärkendes Selbstbild zu entwickeln.
4. Beziehungen neu gestalten
Viele Betroffene haben nach gewaltvollen Erfahrungen Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen oder Grenzen zu setzen. In der Therapie können neue Beziehungsmuster entstehen.
Was können Angehörige tun?
Viele Menschen wissen nicht, wie sie reagieren sollen, wenn ihnen jemand von Gewalt erzählt. Dabei helfen oft schon kleine Schritte:
• Zuhören – ohne zu urteilen
• Betroffene ernst nehmen
• Nicht drängen, sondern unterstützen („Ich bin für dich da, egal wann du bereit bist“)
• Informationen über Hilfsangebote weitergeben
• Eigene Grenzen wahren
Niemand muss allein durch diese Situationen gehen – und auch Angehörige dürfen sich Unterstützung holen.
Warum die 16 Tage gegen Gewalt wichtig sind
Die Kampagne schafft Sichtbarkeit: für Betroffene, für Hilfsmöglichkeiten, für gesellschaftliche Verantwortung. Gewalt passiert nicht „woanders“ – sie passiert überall. Und sie betrifft uns alle.
Die 16 Tage erinnern uns daran, dass Schweigen Gewalt verstärkt – und dass Aufklärung, Sensibilisierung und ein offener Umgang die wichtigsten Schritte sind, um Gewalt zu beenden.
Wo Betroffene Unterstützung finden
• Ärztinnen und Psychotherapeutinnen
• Beratungsstellen für Gewaltbetroffene
• Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen
• Hilfetelefone und Onlineberatungen
• Trauma- und Krisendienste
Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Schritt in Richtung Sicherheit und Selbstbestimmung.
Fazit
Die „16 Tage gegen Gewalt“ sind ein Aufruf hinzuschauen – in Familien, Partnerschaften, Schulen, Online-Räumen und in uns selbst. Psychotherapie kann Menschen auf ihrem Weg aus der Gewalt begleiten, ihnen Stabilität schenken und neue Perspektiven eröffnen.
Jede Unterstützung zählt. Jede Stimme zählt. Jede Geschichte zählt.
Und jeder Mensch verdient ein Leben ohne Angst.

Angst gehört zum Menschsein. Sie schützt uns, warnt uns, hält uns wachsam. Doch wenn Angst zu häufig oder zu intensiv auftritt, wird sie belastend. Viele Betroffene wissen zwar, dass Angst körperlich spürbar ist – Herzrasen, Schwitzen, Druck in der Brust, Tunnelblick – aber nur wenige verstehen, warum das passiert. Dieses Verständnis ist wichtig: Je besser wir Angst biologisch verstehen, desto weniger Angst haben wir vor der Angst. In diesem Artikel erfährst du leicht verständlich, was bei Angst im Körper und Gehirn passiert und warum dich diese Reaktionen nicht gefährden – auch wenn sie sich sehr bedrohlich anfühlen. Warum Angst überhaupt entsteht – unser ältestes Schutzsystem Angst ist ein evolutionäres Warnsystem. Sie soll uns schützen, nicht schaden. Früher warnte sie uns vor Säbelzahntigern – heute reagiert sie oft auf Stress, soziale Situationen oder innere Konflikte. Das Besondere: Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen echten und gedachten Gefahren. Deshalb kann ein Gedanke dieselbe Reaktion auslösen wie eine reale Bedrohung. 🧠 Was im Gehirn passiert, wenn wir Angst haben 1. Die Amygdala – Alarmzentrum des Gehirns Die Amygdala scannt ständig unsere Umgebung. Erkennt sie etwas als potenziell gefährlich, drückt sie den Alarmknopf – schneller, als wir bewusst denken können. 2. Der präfrontale Cortex – der rationale Teil schaltet ab Wenn die Amygdala Alarm schlägt, wird der rational denkende Teil des Gehirns („Chefetage“) kurzzeitig heruntergefahren. Das erklärt: • warum wir in der Angst nicht klar denken • warum rationale Argumente kaum helfen • warum wir uns „nicht unter Kontrolle“ fühlen 3. Hippocampus – Speicher für Erinnerungen Der Hippocampus verknüpft Angsterfahrungen mit Situationen. So entstehen „Trigger“: Der Körper erinnert sich an frühere Angstzustände – selbst wenn die Situation harmlos ist. ⚡ Was im Körper passiert – der Angstkreislauf Wenn die Amygdala feuert, schaltet der Körper in den „Kampf-oder-Flucht-Modus“: 1. Adrenalin & Cortisol werden ausgeschüttet → Herzschlag steigt → Atmung beschleunigt sich → Muskeln spannen sich an Der Körper bereitet sich auf Überleben vor. 2. Blut wird aus dem Bauch abgezogen → Übelkeit → trockener Mund → „Kloß im Hals“ 3. Tunnelblick und Schwindel Der Körper fokussiert nur noch auf „Gefahr“. Das Gehirn spart Energie an nicht überlebenswichtigen Funktionen. 4. Gedankenrasen Schnelle Gedanken sollen Lösungen finden – wirken aber oft katastrophisierend. All diese Symptome sind harmlos, auch wenn sie sich bedrohlich anfühlen. Sie sind biologische Notfallprogramme – keine Anzeichen, dass etwas „nicht stimmt“. 🔄 Warum Angst manchmal außer Kontrolle gerät 1. Das Warnsystem ist zu empfindlich geworden Stress, Erschöpfung oder vergangene Erfahrungen können die Amygdala hypersensibel machen. 2. Fehlalarme werden nicht korrigiert Wenn wir Angst vermeiden, „lernt“ das Gehirn nicht, dass die Situation eigentlich sicher wäre. 3. Angst vor der Angst verstärkt alles Körperliche Signale werden als Gefahr gedeutet → noch mehr Stress → noch mehr Symptome. 💛 Wie das Wissen darüber hilft 1. Angst entdramatisieren Wenn du weißt, dass es „nur“ ein Fehlalarm ist, verlierst du weniger Energie an Katastrophengedanken. 2. Bewusst atmen Langsame Ausatmung signalisiert dem Körper Sicherheit und unterbricht den Stresskreislauf. 3. Körper bewegen Bewegung baut Adrenalin ab und beruhigt. 4. Selbstbeobachtung statt Bewertung „Ich spüre Angst“ statt „Ich halte das nicht aus“ – das verändert die innere Reaktion. 5. Therapeutische Begleitung Therapie hilft, alte Muster zu erkennen, Trigger zu entschärfen und neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Fazit: Angst ist nicht dein Feind – sie ist ein übervorsichtiges Schutzsystem Angst ist biologisch sinnvoll, aber manchmal zu laut eingestellt. Wenn wir wissen, was im Körper und Gehirn passiert, verliert Angst einen großen Teil ihres Schreckens. Du darfst lernen, dieses System zu beruhigen. Und du musst es nicht allein tun.

Manche Kinder scheinen „ungewöhnlich reif“ zu sein: Sie trösten ihre Eltern, übernehmen Verantwortung für Geschwister oder behalten stets den Überblick über das emotionale Klima in der Familie. Was nach Stärke und Hilfsbereitschaft aussieht, kann jedoch einen hohen Preis haben. In der Psychologie spricht man in solchen Fällen von Parentifizierung. Dieser Artikel erklärt verständlich, was Parentifizierung bedeutet, wie sie entsteht, welche Folgen sie haben kann – und was Betroffenen hilft. Was bedeutet Parentifizierung? Parentifizierung beschreibt eine Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind. Das Kind übernimmt Aufgaben oder Verantwortungen, die eigentlich den Erwachsenen zustehen. Dabei geht es nicht um gelegentliche Mithilfe im Haushalt, sondern um eine dauerhafte Überforderung des Kindes. Man unterscheidet zwei Hauptformen: 1. Instrumentelle Parentifizierung Das Kind übernimmt praktische Aufgaben, zum Beispiel: • Versorgung jüngerer Geschwister • Haushalt, Kochen, Organisieren • Übersetzen oder Behördengänge für die Eltern 2. Emotionale Parentifizierung Hier wird es besonders belastend. Das Kind: • tröstet einen Elternteil regelmäßig • vermittelt bei Konflikten zwischen Erwachsenen • fühlt sich verantwortlich für die Stimmung oder Stabilität der Eltern Gerade die emotionale Parentifizierung bleibt oft unsichtbar – und wirkt dennoch tief. Wie kommt es zu Parentifizierung? Parentifizierung entsteht meist nicht aus böser Absicht. Häufige Auslöser sind: • psychische Erkrankungen oder Sucht eines Elternteils • chronische körperliche Erkrankungen • Trennung, Scheidung oder Tod • Überforderung, Armut oder Migration • emotionale Unreife der Eltern In solchen Situationen „springt“ das Kind ein – oft, weil sonst niemand da ist. Warum Kinder diese Rolle annehmen Kinder sind stark auf Bindung angewiesen. Wenn sie spüren, dass ein Elternteil sie braucht, entwickeln sie oft unbewusst folgende Überzeugungen: • „Ich muss helfen, damit alles funktioniert.“ • „Meine Bedürfnisse sind weniger wichtig.“ • „Ich werde geliebt, wenn ich stark bin.“ Das Kind sichert so Nähe und Zugehörigkeit – auch wenn es sich selbst dabei verliert. Mögliche Folgen im Erwachsenenalter Nicht jedes parentifizierte Kind entwickelt später Probleme. Doch viele Betroffene berichten im Erwachsenenalter von: • Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen • übermäßigem Verantwortungsgefühl für andere • Problemen mit Nähe und Abgrenzung • Perfektionismus oder starker Selbstkritik • Schuldgefühlen beim Nein-Sagen • Erschöpfung, Depression oder Angst Häufig taucht das Muster in Partnerschaften oder im Beruf erneut auf: Man kümmert sich, hält alles zusammen – und bleibt selbst auf der Strecke. Woran erkenne ich Parentifizierung bei mir selbst? Ein paar typische Fragen zur Selbstreflexion: • Fiel es mir als Kind schwer, einfach „Kind zu sein“? • War ich oft der/die Vernünftige oder Starke in der Familie? • Habe ich früh gelernt, meine Gefühle zurückzustellen? • Fühle ich mich schnell verantwortlich für das Wohl anderer? Wenn Sie sich hier wiedererkennen, kann das ein Hinweis sein – keine Diagnose, aber ein möglicher Schlüssel zum Verstehen eigener Muster. Was hilft bei der Verarbeitung? Der wichtigste Schritt ist oft Erkennen und Benennen. Weitere hilfreiche Ansätze sind: • Selbstmitgefühl entwickeln: Das Kind von damals hat getan, was nötig war. • Eigene Bedürfnisse (neu) kennenlernen und ernst nehmen • Grenzen üben – ohne Schuldgefühle • alte Loyalitäten hinterfragen („Ich muss das allein schaffen“) • psychotherapeutische Begleitung, um die Rolle bewusst zu verlassen Heilung bedeutet nicht, die Familie abzulehnen – sondern sich selbst den Platz zu geben, der früher gefehlt hat. Zum Schluss Parentifizierung ist eine stille, oft übersehene Erfahrung. Viele Betroffene wirken nach außen kompetent und stabil – innerlich jedoch erschöpft. Zu verstehen, was damals passiert ist, kann entlastend und befreiend sein. Denn: Kinder dürfen Kinder sein. Und Erwachsene dürfen heute lernen, sich selbst zu halten. ________________________________________ Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine Psychotherapie. Wenn Sie sich stark belastet fühlen, kann professionelle Unterstützung sehr hilfreich sein.

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) wird noch immer häufig mit unruhigen Jungen in der Schulklasse verbunden. Doch das Bild täuscht: ADHS betrifft auch viele Frauen – oft bleibt es jedoch jahrzehntelang unerkannt. Die Symptome zeigen sich bei ihnen anders, subtiler, innerlicher. Viele Frauen entdecken erst im Erwachsenenalter, dass die ständige Erschöpfung, das Chaos im Kopf und die Selbstzweifel einen Namen haben: ADHS. Warum ADHS bei Frauen so oft übersehen wird Bei Mädchen und Frauen zeigt sich ADHS häufig nicht durch Hyperaktivität, sondern durch Unaufmerksamkeit, emotionale Überlastung und innere Unruhe. Da diese Anzeichen weniger auffallen, wird ADHS oft als Depression, Angststörung oder Burnout fehlinterpretiert. Typische Gründe, warum ADHS bei Frauen übersehen wird: Mädchen passen sich häufig besser an und verhalten sich „brav“. Emotionale Probleme werden als „Sensibilität“ oder „Launen“ abgetan. Erwachsene Frauen kompensieren durch Perfektionismus und Überanpassung. Gesellschaftliche Erwartungen („funktionieren“, „organisiert sein“) überdecken die Symptome. Typische Symptome von ADHS bei Frauen Die Symptome lassen sich in drei Hauptbereiche einteilen: Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität und emotionale Dysregulation. Viele Frauen berichten, dass sie sich ihr ganzes Leben lang „anders“ gefühlt haben – chaotisch, reizbar, überfordert oder getrieben. 1. Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit und Organisation ständiges Vergessen (Termine, Gegenstände, Aufgaben) Probleme, Prioritäten zu setzen oder Projekte zu Ende zu bringen Neigung zum Aufschieben (Prokrastination) leicht ablenkbar – Gedanken springen ständig hin und her „Hyperfokus“: völliges Aufgehen in einer Sache und alles andere vergessen 2. Innere Unruhe und Impulsivität Gefühl, innerlich ständig unter Strom zu stehen schnelles Handeln aus dem Bauch heraus, ohne nachzudenken Schwierigkeiten, abzuschalten oder zu entspannen ständiger Rededrang oder schnelles Denken plötzliche Stimmungsschwankungen 3. Emotionale Sensibilität starke Reaktionen auf Kritik oder Ablehnung intensive Emotionen – Freude, Wut, Trauer oder Begeisterung sind „größer“ hohe Empathie, aber auch emotionale Erschöpfung Tendenz zu Überforderung, Perfektionismus und Selbstzweifeln 4. Körperliche und alltägliche Begleiterscheinungen chronische Erschöpfung durch ständige Reizverarbeitung Schlafprobleme oder unregelmäßiger Tagesrhythmus unstrukturierter Alltag, Schwierigkeiten mit Zeitmanagement häufige Überforderung im Beruf, Haushalt oder in Beziehungen ADHS bei Frauen im Alltag – zwischen Hochleistung und Zusammenbruch Viele betroffene Frauen sind außergewöhnlich leistungsfähig, solange sie unter Druck stehen. Doch sobald der Druck nachlässt, bricht das fragile System aus Organisation, Stress und Selbstkritik in sich zusammen. Das führt oft zu Erschöpfung, Schuldgefühlen und dem Gedanken: „Warum schaffe ich das nicht wie andere?“ Gerade im Beruf oder in der Familie wird ADHS dann spürbar – in chaotischen Schreibtischen, verpassten Terminen, plötzlicher Überforderung oder Konflikten, die aus emotionaler Reizbarkeit entstehen. Wie Psychotherapie helfen kann Eine psychotherapeutische Begleitung kann helfen, das eigene Erleben zu verstehen und neue Strategien zu entwickeln. In der Therapie geht es nicht nur um Konzentration, sondern um Selbstakzeptanz und emotionale Balance. Psychotherapie kann Frauen mit ADHS helfen: die eigenen Muster zu erkennen und zu verstehen realistische Strukturen und Routinen aufzubauen Perfektionismus und Scham loszulassen emotionale Regulation und Selbstmitgefühl zu stärken und die eigenen Stärken – Kreativität, Empathie, Begeisterung – bewusst zu nutzen ADHS bei Frauen – keine Schwäche, sondern ein anderes Denken ADHS ist keine Charakterschwäche und kein Mangel an Disziplin. Es ist eine neurobiologische Besonderheit, die andersartige Reizverarbeitung, Wahrnehmung und Energie mit sich bringt. Viele Frauen erleben nach einer Diagnose nicht nur Erleichterung, sondern auch die Chance, ihr Leben neu zu gestalten – mit Verständnis, Struktur und Mitgefühl für sich selbst. Fazit ADHS bei Frauen ist weit verbreiteter, als viele glauben. Die Symptome sind oft leiser, aber nicht weniger belastend. Wer sich in den beschriebenen Anzeichen wiedererkennt, sollte den Schritt wagen und professionelle Unterstützung suchen – der Weg zu mehr Klarheit, Ruhe und Selbstakzeptanz lohnt sich.

Die Polyvagal-Theorie sorgt seit einigen Jahren in der Psychotherapie für viel Aufmerksamkeit – und das aus gutem Grund. Sie bietet eine verständliche Erklärung dafür, warum wir in bestimmten Situationen ruhig, gestresst oder wie gelähmt reagieren. Dieser Artikel erklärt die Theorie so einfach wie möglich und zeigt, warum sie für Stressregulation, Trauma-Verständnis und psychische Gesundheit so bedeutsam ist. Was ist die Polyvagal-Theorie? – Eine einfache Erklärung Die Polyvagal-Theorie wurde vom Neurobiologen Stephen Porges entwickelt. Sie beschreibt, wie unser autonomes Nervensystem – also der Körperteil, der ohne unser bewusstes Zutun arbeitet – auf Sicherheit und Gefahr reagiert. Während man früher von nur zwei Zuständen ausging, Erholung (Parasympathikus) und Alarm (Sympathikus), ergänzt die Polyvagal-Theorie eine dritte, entscheidende Ebene: den ventralen Vagus, der soziale Verbundenheit ermöglicht. Die Theorie unterscheidet somit drei biologische Grundzustände, die erklären, warum wir so fühlen und handeln, wie wir es tun. Die drei Zustände des Nervensystems 1. Ventral-vagaler Zustand : Sicherheit und soziale Verbindung Dieser Zustand aktiviert unser „soziales Nervensystem“. Wir fühlen uns sicher, verbunden, offen und handlungsfähig. Typische Merkmale: ruhige Atmung, klare Gedanken, freundliche Mimik. 2. Sympathischer Zustand: Kampf oder Flucht Der Körper geht in Alarmbereitschaft – eine automatische Stressreaktion. Typisch: Herzklopfen, Unruhe, hohe Anspannung, Reizbarkeit. 3. Dorsal-vagaler Zustand: Shutdown und Rückzug Wenn Stress überwältigend wird und keine Lösung möglich scheint, fährt der Körper herunter. Typisch: Erschöpfung, emotionale Taubheit, Antriebslosigkeit, Rückzug. Alle drei Zustände sind biologisch sinnvoll. Ungesund wird es erst, wenn wir darin feststecken. Warum ist die Polyvagal-Theorie wichtig für Psychotherapie und Selbsthilfe? Immer mehr therapeutische Ansätze nutzen das polyvagale Verständnis, weil es erklärt: • warum manche Stressreaktionen „wie aus dem Nichts“ kommen • warum Trauma oft körperlich gespeichert wird • warum Sicherheit heilend wirkt • warum Atemübungen, Körperarbeit und Achtsamkeit so effektiv sind Die Theorie zeigt: Das Nervensystem entscheidet schneller als der Verstand. Wenn wir lernen, die Signale des Körpers zu verstehen, können wir Stress besser regulieren – und uns schneller wieder sicher fühlen. Wie du dein Nervensystem beruhigen kannst – polyvagale Übungen für den Alltag 1. Länger ausatmen als einatmen Der verlängerte Ausatem aktiviert den ventralen Vagus und beruhigt das Nervensystem. 2. Verbindung suchen Kurzer Blickkontakt mit einer vertrauten Person, ein freundliches Gespräch oder Lachen – all das stärkt das „soziale System“. 3. Erdungstechniken Füße bewusst auf dem Boden spüren, Hände auf die Brust legen, Präsenz im Körper herstellen. 4. Bewegung bei Stress Spazieren gehen, strecken, leichtes Schütteln – alles hilft, überschüssige Aktivierung abzubauen. 5. Sicherheit durch Sinneseindrücke Wärme, sanfte Musik, angenehme Düfte – kleine Sinnesreize signalisieren dem Nervensystem: „Du bist sicher.“ Ein Fazit für deinen Alltag Die Polyvagal-Theorie verbindet moderne Neurobiologie mit alltäglichen Erfahrungen. Sie erklärt, warum wir in Momenten von Stress, Nähe, Angst oder Überforderung so reagieren, wie wir reagieren. Vor allem aber zeigt sie, dass: • unsere Reaktionen kein persönliches Versagen sind • sondern biologische Schutzmechanismen • die wir beeinflussen lernen können Wer versteht, wie das eigene Nervensystem arbeitet, kann freundlicher mit sich selbst umgehen, Stress früher erkennen und gezielt in Richtung Sicherheit steuern.

Viele Menschen kennen dieses Muster: Man verliebt sich neu – und merkt nach einiger Zeit, dass die Beziehung sich erstaunlich vertraut anfühlt. Wieder die gleichen Konflikte. Wieder die gleichen Verletzungen. Wieder das Gefühl, „irgendwie kenne ich das alles schon“. Doch warum geraten wir immer wieder in ähnliche Beziehungskonstellationen? Und wieso fällt es so schwer, wirklich andere Partner:innen zu wählen? Die Antwort hat weniger mit Pech zu tun, als viele glauben. Sie liegt tief in unserer Bindungsbiografie und den Mustern, die wir früh gelernt haben. Dieser Artikel zeigt dir verständlich, warum wir uns immer wieder dieselben Partner:innen aussuchen – und wie du diesen unbewussten Kreislauf verändern kannst. Warum Wiederholungen in Beziehungen kein Zufall sind Unsere Partnerwahl wird stark von Erfahrungen geprägt, die wir in der Kindheit gemacht haben: • Wie wurde mit uns gesprochen? • Was mussten wir tun, um Nähe zu bekommen? • Wie wurde mit Konflikten umgegangen? • Durften wir Bedürfnisse haben? Diese frühen Erlebnisse formen Bindungsmuster, die später im Erwachsenenalter wirken – oft unsichtbar, aber machtvoll. Wir suchen selten das, was uns guttut. Wir suchen das, was uns vertraut ist. Und Vertrautheit fühlt sich an wie „Liebe“, auch wenn sie uns gar nicht gut tut. 🔄 Warum wir immer wieder ähnliche Partner:innen wählen 1. Vertrautheit fühlt sich sicher an – selbst wenn sie schmerzt Das Gehirn liebt Wiederholung. „Bekannt“ wird automatisch mit „sicher“ verwechselt. Ein Beziehungsmuster kann sich deshalb richtig anfühlen, obwohl es uns belastet. 2. Unbewusste Bindungsmuster steuern unsere Wahl Menschen mit ähnlichen Bindungserfahrungen ziehen sich oft an. Beispiel: • Wer Zuneigung nur gegen Leistung gelernt hat, sucht Partner:innen, die schwer erreichbar sind. • Wer Nähe als bedrohlich erlebt hat, fühlt sich von emotional distanzierten Menschen angezogen. 3. Wir hoffen, die alte Geschichte endlich „richtig zu machen“ Psychologisch nennt man das Wiederholungszwang. Wir wählen Partner:innen, die uns an frühe Bezugspersonen erinnern, in der unbewussten Hoffnung: „Diesmal gelingt es mir, geliebt zu werden, wie ich bin.“ 4. Selbstwert spielt eine große Rolle Wer seinen eigenen Wert nicht fühlt, wählt Menschen, die diesen inneren Zweifel spiegeln. So entstehen Beziehungen, in denen man sich ständig anstrengt, aber selten gesehen fühlt. 5. Unsere blinden Flecken bestimmen, wen wir attraktiv finden Oft verwechseln wir Anziehung mit Intensität: Drama, Unsicherheit oder starke Schwankungen werden als „Chemie“ interpretiert – obwohl sie eher emotionale Alarmzeichen sind. 💛 Wie wir den Kreislauf durchbrechen können 1. Muster erkennen – das ist der wichtigste Schritt Fragen, die helfen: • Welche Art von Menschen zieht mich immer wieder an? • Welche Situationen wiederholen sich? • Wie fühle ich mich meist in Beziehungen – und woher kenne ich dieses Gefühl? Bewusstsein verändert alles. 2. Langsam werden – nicht sofort der Anziehung folgen Schnelle Verliebtheit verschleiert oft Warnsignale. Wer lernt, Anziehung zu beobachten, statt ihr blind zu folgen, kann bewusster wählen. 3. Den eigenen Wert stärken Je klarer der Selbstwert, desto leichter erkennt man, was man verdient – und was nicht. 4. Neue Erfahrungen zulassen Manchmal sind die Menschen, die uns guttun würden, die, die sich am Anfang „ungewohnt ruhig“ oder „zu freundlich“ anfühlen. Das Ungewohnte ist oft das Gesunde. 5. Professionelle Begleitung Therapie hilft, alte Bindungsmuster sichtbar zu machen und sicherere Formen von Beziehung aufzubauen. Denn oft braucht es nicht „den richtigen Menschen“ – sondern innere Klarheit. Fazit: Muster sind mächtig – aber nicht stärker als Bewusstsein Wir wählen Partner:innen nicht zufällig. Wir wiederholen das, was wir kennen. Doch sobald wir verstehen, was in uns wirkt, beginnt Veränderung: 👉 wir fühlen klarer, 👉 wir wählen bewusster, 👉 wir schaffen Platz für Beziehungen, die wirklich guttun. Du musst deine Vergangenheit nicht wiederholen. Du darfst etwas Neues wählen.

Gegen Ende des Jahres verändert sich oft etwas in uns. Die Tage werden kürzer, das Tempo draußen scheint sich zu verlangsamen – und manchmal entsteht ein Raum, in dem Gedanken lauter werden. Viele Menschen spüren in dieser Zeit den Wunsch, innezuhalten: zurückzublicken, zu sortieren, vielleicht auch zu verstehen. Im psychotherapeutischen Sinn ist das Jahresende kein natürlicher „Abschluss“, sondern ein symbolischer. Und genau darin liegt seine Kraft. Symbole helfen uns, innere Prozesse greifbar zu machen. Rückblick: Was war eigentlich los in meinem Jahr? Reflexion bedeutet nicht, eine Bilanz im Sinne von „gut“ oder „schlecht“ zu ziehen. Vielmehr geht es darum, wahrzunehmen: Was hat mich dieses Jahr beschäftigt? Welche Situationen haben mich Kraft gekostet – und welche haben mir Energie gegeben? Gab es Momente, in denen ich mir selbst näher war als sonst? Manche Menschen merken, dass sie vor allem auf das schauen, was nicht gelungen ist. Das ist menschlich – unser Gehirn ist sehr gut darin, Fehler zu speichern. Eine hilfreiche Übung kann sein, bewusst auch nach dem Unscheinbaren zu suchen: kleine Fortschritte, überstandene Krisen, leise Entscheidungen. Gefühle am Jahresende: Alles darf da sein Nicht selten mischen sich zum Jahresende ganz unterschiedliche Gefühle: Dankbarkeit und Traurigkeit, Erleichterung und Müdigkeit, Hoffnung und Sorge. Gerade in einer Gesellschaft, die den Jahreswechsel oft mit Optimismus und Vorsätzen verbindet, kann das irritierend sein. Aus psychotherapeutischer Sicht ist wichtig: Gefühle müssen nicht „passen“. Sie sind keine To-do-Liste. Wenn sich Melancholie zeigt, darf sie da sein. Wenn Leere spürbar wird, kann auch das eine wichtige Information sein – vielleicht über Erschöpfung, vielleicht über unerfüllte Bedürfnisse. Reflexion ohne Selbstverurteilung Reflexion wird dann belastend, wenn sie in inneren Vorwürfen endet. Fragen wie „Warum bin ich immer noch nicht weiter?“ oder „Andere kriegen das doch auch hin“ führen selten zu Wachstum. Hilfreicher sind freundlichere, offenere Fragen, zum Beispiel: Was habe ich dieses Jahr über mich gelernt? In welchen Momenten habe ich versucht, gut für mich zu sorgen – auch wenn es nicht perfekt war? Was wünsche ich mir weniger für das kommende Jahr? (Nicht nur: mehr.) Diese Haltung nennt man in der Therapie oft eine wohlwollende Selbstbeobachtung. Ausblick: Kleine Ausrichtungen statt großer Vorsätze Das neue Jahr muss kein neues Ich hervorbringen. Große Vorsätze scheitern oft nicht an mangelnder Disziplin, sondern an zu hohen Erwartungen. Vielleicht reicht eine leise Ausrichtung: etwas mehr Pausen, etwas mehr Ehrlichkeit mit sich selbst, etwas weniger Härte im inneren Dialog. Manchmal ist der wichtigste Schritt nicht nach vorne, sondern nach innen. Zum Schluss Das Jahresende ist keine Prüfung und kein Zeugnis. Es ist eine Einladung. Eine Einladung, kurz stehen zu bleiben, zurückzuschauen – und sich selbst dabei mit etwas mehr Verständnis zu begegnen. Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich in den kommenden Tagen ein paar ruhige Minuten. Nicht, um Antworten zu finden. Sondern um zuzuhören.

Der Jahreswechsel fühlt sich für viele wie ein Neustart an. Ein leeres Kalenderblatt, ein symbolischer Anfang, ein Versprechen an uns selbst: „Dieses Jahr wird alles anders.“ Doch kaum sind die ersten Wochen vergangen, rutschen viele wieder in alte Gewohnheiten zurück. Die Vorsätze geraten in Vergessenheit, und zurück bleiben Frust, Scham oder das Gefühl, „es wieder nicht geschafft zu haben“. Warum ist das so? Und wie kann man Neujahrsvorsätze so gestalten, dass sie tatsächlich gut tun – statt Druck zu machen? In diesem Artikel erfährst du, was psychologisch hinter dem Jahreswechsel steckt, warum gute Vorsätze oft scheitern und wie du Ziele findest, die wirklich zu dir passen. Warum der Jahreswechsel emotional so stark wirkt Der Übergang in ein neues Jahr löst bei vielen Menschen ein Gefühl von Hoffnung aus. Gleichzeitig wirkt er wie ein Spiegel: • Was lief dieses Jahr gut? • Was möchte ich ändern? • Was fehlt mir? Psychologisch betrachtet ist der Jahreswechsel ein „natürlicher Reflexionspunkt“ – ähnlich wie Geburtstage oder große Lebensereignisse. Er lädt ein, Ziele zu formulieren. Aber er lädt auch dazu ein, unrealistische Erwartungen an sich selbst zu stellen. Warum Neujahrsvorsätze so oft scheitern 1. Ziele sind zu groß oder zu unklar „Ab jetzt werde ich …“ ist ein klassischer Vorsatzanfang, aber oft ohne klare Umsetzung. Das Gehirn braucht Konkretes, keine Ideale. 2. Wir unterschätzen unsere Gewohnheiten Gewohnheiten sind tief verankert. Ohne konkrete Strategien greifen alte Muster automatisch wieder. 3. Vorsätze entstehen aus Selbstkritik, nicht aus Selbstverbundenheit Viele setzen Vorsätze aus dem Gefühl heraus, nicht gut genug zu sein. Doch Veränderung entsteht leichter aus Selbstfürsorge als aus Selbstabwertung. 4. Wir arbeiten gegen unsere Identität – statt mit ihr Wenn ein Ziel nicht zu unserem Selbstbild passt („Ich bin halt unsportlich“), wird das Umsetzen schwer. 5. Schuldgefühle lähmen statt motivieren Scheitern an Vorsätzen führt oft zu Scham – und die führt selten zu Veränderung. Wie Vorsätze gelingen können – psychologisch fundierte Strategien 1. Klein statt groß – Mikroziele setzen Statt: „Ich mache jetzt täglich Sport.“ Besser: „Ich bewege mich 10 Minuten am Tag.“ Kleine Erfolge schaffen Motivation, keine Überforderung. 2. Ziele positiv formulieren Nicht: „Ich höre auf, mich schlecht zu ernähren.“ Sondern: „Ich möchte meinem Körper mehr Energie geben.“ 3. Realistisch bleiben Frage dich: • Ist dieses Ziel erreichbar? • Passt es zu meinem Leben? • Habe ich Ressourcen dafür? 4. Bedürfnisse erkennen statt Ideale verfolgen Vorsätze sollten Antworten auf echte Bedürfnisse sein: Ruhe, Gesundheit, soziale Verbindung, Grenzen, Selbstwirksamkeit. 5. Rückschritte einplanen Veränderung ist kein linearer Weg. Wenn ein Tag nicht klappt, ist das kein Scheitern – sondern normal. 6. Identität stärken Statt „Ich muss mehr lesen“: „Ich möchte ein Mensch sein, der sich Zeit für Wissen nimmt.“ Identitätsziele sind stabiler als reine Verhaltensvorgaben. Warum Selbstmitgefühl der wichtigste Erfolgsfaktor ist Der härteste Antreiber ist oft die innere Stimme, die sagt: „Du musst besser werden.“ Doch psychologische Forschung zeigt: Menschen verändern sich nachhaltiger, wenn sie freundlich mit sich umgehen. Selbstmitgefühl reduziert Stress, erhöht Motivation und unterstützt langfristige Gewohnheitsänderungen. Fazit: Neujahrsvorsätze müssen nicht scheitern – wenn wir sie anders denken Der Jahreswechsel kann ein schöner Moment der Reflexion sein. Aber Veränderung entsteht nicht durch Druck – sondern durch Klarheit, kleine Schritte und eine freundliche innere Haltung. Du musst nicht alles neu erfinden. Aber du kannst entscheiden, welchen nächsten kleinen Schritt du gehen willst.